
Verzaubert, bezirzt, entzückt, betört, unserer Vernunft beraubt. Das sind wir, wenn im japanischen Erfolgsfilm «Kokuho – The Master of Kabuki» (2025) die beiden Protagonisten in ihren farbenprächtigen Kimonos auf die Bühne treten. Sie tanzen, singen, mimen, sprechen, kämpfen, lachen, lieben, leiden, sterben. Selbst wenn wir nicht allzu genau wissen, was wir da gerade sehen, so fasziniert das Kabuki-Theater dennoch. Sicherlich, weil es für viele (mich eingeschlossen) sehr fremd ist. Aber auch, weil wir uns der Anmut dieser Kunst kaum entziehen können.
Die gegenwärtige Form des Kabuki entwickelte sich in der Genroku-Ära (1688–1704). In seiner «Geschichte Japans» beschreibt Japanologe Hans Martin Krämer jene Periode als «Blütezeit der frühneuzeitlichen japanischen Kultur». Besonders in Edo, dem heutigen Tokio, boomten bürgerliche Künste wie die Gedichtform des Haiku oder die Bildherstellung mit Farbholzschnitten (Ukiyo-e) und trafen auf ein begeistertes Publikum. Im Lauf der Jahrhunderte stiegen diese Kunstrichtungen in die Hochkultur auf. Unter ihnen auch das Kabuki, das die Elemente Gesang (ka), Tanz (bu) und Schauspielkunst (ki) kombiniert. Anders als das mittelalterliche Nō-Theater griff es kaum religiöse Stoffe auf, sondern erzählte von den Dramen der Städter:innen und der Krieger.

Mit anderen Worten: Kabuki war in der Edo-Zeit – genau wie das Kino heute – eine Massenkunst, die immer die Geschmäcker und Moden einer breiten Bevölkerung widerspiegelte. Kein Wunder, fand jene Theaterform 1896, als der Film Japan erreichte, «nahtlosen Anschluss an das neue Medium», wie die Filmwissenschaftlerin Kayo Adachi-Rabe in ihrem Buch «Der japanische Film» schreibt. Dazu passt, dass «Momijigari» von 1899, der älteste erhaltene japanische Streifen, nichts anderes ist als eine sechsminütige Aufzeichnung eines – ihr dürft raten! – Kabuki-Stücks mit demselben Titel.
Und damit wären wir wieder bei «Kokuho», dem Film, der die Kabuki-Bühnen zu seinem Schauplatz macht. In Japan allein spielte das knapp dreistündige Drama des japanisch-koreanischen Regisseurs Lee Sang-il umgerechnet über 111 Millionen US-Dollar ein und ist in seinem Herkunftsland mittlerweile der erfolgreichste Realfilm aller Zeiten. Nur sieben Anime-Produktionen spülten mehr Geld in die japanischen Kinokassen als «Kokuho». Darunter der ebenfalls 2025 veröffentlichte «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle».
Sogar auf einen Oscar darf das Kabuki-Drama hoffen. Kürzlich publizierte die Academy of Motion Picture Arts and Sciences die Shortlist für den wichtigsten Filmpreis Hollywoods. In der Kategorie «Bester internationaler Film» ist auch «Kokuho» aufgeführt. Wenn die Academy am 22. Januar die Nominierungen für die nächste Verleihung bekannt gibt, könnte der Streifen offiziell zum Oscar-Kandidaten werden.
Onnagata: Männer, die Frauen spielen
Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Schriftsteller Shūichi Yoshida erzählt «Kokuho» die Geschichte von Kikuo Tachibana (als Jugendlicher: Sōya Kurokawa, als Erwachsener: Ryo Yoshizawa), einem schauspielerischen Naturtalent und Sohn des Yakuza-Bosses Gongorō (Masatoshi Nagase). Nachdem Gongorō eines Abends von einem feindlichen Gangster-Clan ermordet wird, findet Kikuo Zuflucht bei dem Kabuki-Meister Hanai Hanjiro II (Ken Watanabe) und entschliesst sich, bei ihm in die Lehre zu gehen. Zusammen mit Hanjiros einzigem Sohn Shunsuke (als Jugendlicher: Keitatsu Koshiyama, als Erwachsener: Ryusei Yokohama) strebt er fortan danach, die grossen Theaterbühnen zu erobern.
Filmfakten
Originaltitel: 国宝 (Kokuhō)
Regie: Lee Sang-il
Drehbuch: Satoko Okudera
Mit: Ryo Yoshizawa, Ryusei Yokohama, Ken Watanabe, Soya Kurokawa, Keitatsu Koshiyama, Mitsuki Takahata, Nana Mori, Shinobu Terajima, Min Tanaka
Produktionsland: Japan
Länge: 174 Minuten
Kinostart Deutschschweiz: 25. Dezember 2025
Die Besonderheit der Geschichte: Kikuo und Shunsuke werden Onnagata – Kabuki-Darsteller, die Frauenrollen verkörpern. Bis heute ist diese japanische Form des Theaters fast ausschliesslich mit Männern besetzt. Die Gründe dafür führen uns zurück ins 17. Jahrhundert, zur Geburtsstunde des Kabuki.
Im Jahr 1603 begann das Schreinmädchen Okuni, kleine Gesangs- und Tanzaufführungen in Kyoto zu organisieren. Ihre Stücke, die allesamt nur mit Frauen besetzt waren, handelten von historischen Ereignissen, von Liebe oder von anderen alltäglichen Erfahrungen der Menschen. Sofort erfreuten sich die Darbietungen grosser Beliebtheit, woraufhin Okuni und ihre Damen am kaiserlichen Hof in Kyoto auftreten durften. Dies führte dazu, dass weitere Frauentruppen entstanden, die in der ehemaligen Hauptstadt und darüber hinaus ihre Gesangs- und Tanzfähigkeiten zur Schau stellten.
Dabei spielten sie oft mit provokativen und erotischen Elementen. In der Regel stammten die Schauspielerinnen aus den untersten Klassen der japanischen Gesellschaft. Dazu gehörten viele Prostituierte, die hinter den Kabuki-Bühnen ihrem Gewerbe nachgingen. Mit der Begründung, dass die Aufführungen geltende moralische Vorstellungen mit Füssen treten würden, verbannte die Regierung alle Frauen aus dem Kabuki.
Tatsächlich verbarg sich hinter dem Verbot jedoch ein anderer Grund: Das Shogunat störte sich vor allem daran, dass das Kabuki bei allen Bevölkerungsschichten grossen Anklang fand und sich niedere sowie höhere Stände im Publikum vermischten.
Die Tokugawa-Regierung etablierte im 17. Jahrhundert eine strenge Vierständegesellschaft, eingeteilt in die als überflüssig erachteten Kaufleute, die nützlichen Handwerker, die Bauern, die die Lebensgrundlage aller sicherten, und die Krieger, die als Adel das Volk lenken sollten. «Im Selbstverständnis der Zeit war eine statische Gesellschaft der beste Garant für Ordnung, Sicherheit und Frieden», schreibt der Japanologe Hans Martin Krämer. Dass sich nun verschiedene Stände in den Rängen der Kabuki-Theater mischten, passte dem Shogunat überhaupt nicht in den Kram und gefährdete dessen Ordnung.
Da Frauen von den Bühnen verbannt waren, hoffte die Regierung, dass das Kabuki an Popularität verlieren und die Kunstform gänzlich verschwinden würde. Dem war aber nicht so. Stattdessen entstanden die Onnagata: Männer schlüpften einfach in Kimonos und spielten die Frauenrollen selbst. Einige kriegte man kaum mehr aus den Damenkleidern heraus.
Im 18. Jahrhundert, als das Kabuki am Höhepunkt seiner Beliebtheit war, kleideten und verhielten sich die angesehensten Onnagata auch fernab des Theaters wie Frauen. Diejenigen, die in Herrenklamotten oder gar in Begleitung ihrer Ehefrau gesichtet wurden, riskierten, in der Presse verrissen zu werden.
Während der Meiji-Restauration im späten 19. Jahrhundert erlaubte die neue Regierung den Frauen, auf die Kabuki-Bühnen zurückzukehren. Kaum eine wagte aber, dies zu tun. Zwar gibt es heute durchaus Kabuki-Schauspielerinnen, jedoch bleiben sie eine Minderheit. Die Erhaltung der Onnagata-Tradition scheint ein wichtiger Grund dafür zu sein.
Ein lebender Nationalschatz Japans
Auffallend ist, dass auch in «Kokuho» Frauen eine untergeordnete Rolle spielen. Sie erscheinen entweder als Liebhaberinnen und Ehegattinnen oder als Mütter. Die einzigen relevanten Damen bleiben diejenigen, die von Männern verkörpert werden.
Neben den beiden Hauptfiguren Kikuo und Shunsuke kommt wiederholt der Meister-Onnagata Mangiku (Min Tanaka) vor, der für die Jungs als Vorbild dient. Als sie Mangiku auf der Bühne sehen, wie er den berühmten Tanz der Reiherjungfrau (Sagi Musume) vorführt, wird er als lebender Nationalschatz bezeichnet.
Und das ist nicht bloss eine Floskel oder eine Metapher für das überragende Können des Meisters, sondern der umgangssprachliche Titel für Künstler:innen, die der Staat offiziell als «Halter wichtiger immaterieller Kulturgüter» auszeichnet.
Ein japanischer Nationalschatz (Kokuhō) kann ein materielles oder immaterielles Kulturgut sein. Schwerter, Gemälde oder Bauwerke sind Beispiele für materielle Kulturgüter, die der Minister für Bildung, Kultur, Sport, Wissenschaft und Technologie zum Nationalschatz Japans ernennen kann.
Immaterielle Kulturgüter sind Bühnenkünste wie das Kabuki oder Handwerkstechniken wie die Stofffärberei. Meister:innen dieser Künste können zum lebenden Nationalschatz (Ningen Kokuhō) ernannt werden, genau wie Mangiku im Film. Laut dem Online-Magazin «Sumikai» diskutiert die Regierung aktuell sogar eine Reform des 1954 eingeführten Systems der «wichtigen immateriellen Kulturgüter». Neu sollen Koryphäen von Alltagskünsten wie dem Kochen, der Kalligrafie oder der Sake-Braukunst ebenfalls den Titel eines lebenden Nationalschatzes erhalten dürfen.
Die Ernennung eines lebenden Nationalschatzes würdigt weniger die Person als die Kunst, die für kommende Generationen bewahrt werden soll. Hervorgehoben wird das dadurch, dass Titelhalter:innen verpflichtet sind, in ihrem Feld weiterhin aktiv zu sein und ihre Fertigkeiten an Lehrlinge weiterzugeben.
Kunst als Leistungssport
Wir haben es bei den lebenden Nationalschätzen also mit Menschen zu tun, die ihr Leben dem Handwerk und der Schönheit ihrer Kunst widmen. Seltsamerweise erzählt «Kokuho» kaum von der Kunst des Kabuki – obwohl er uns interessante Blicke auf und hinter die Bühne jener traditionsreichen Theaterform gewährt. Das ist die grosse Krux des Films.
In «Kokuho» wird Kunst zum Leistungssport. Der Protagonist Kikuo geniesst es, an seine körperlichen und geistigen Grenzen getrieben zu werden – selbst wenn das bedeutet, Misshandlungen zu ertragen. Um der beste Kabuki-Schauspieler Japans zu werden, dieses eine Ziel zu erreichen, nimmt er alles in Kauf: Er manipuliert Familie und Freunde, verletzt sie und lässt sie im Stich.
Das erinnert immer wieder an Damien Chazelles «Whiplash» (2014), in dem der Jazzlehrer und Bandleader Fletcher (J. K. Simmons) den 19-jährigen Schlagzeuger Andrew (Miles Teller) zu Höchstleistungen antreibt – und das, indem er ein Regime der Angst und Gewalt errichtet. Das Fürchterliche an «Whiplash» ist, dass Damien Chazelle die Methoden von Fletcher nicht hinterfragt, sondern honoriert. Ähnliches tun auch Drehbuchautorin Satoko Okudera und Regisseur Lee Sang-il in «Kokuho».
«Wo ist die aufrichtige Freude am Kabuki?», habe ich mich andauernd gefragt. Nur ein einziges Mal, ganz zu Anfang des Films, sehen wir in Kikuo ehrliches Vergnügen an der Theaterkunst, die reine Lust, vor einem Publikum aufzutreten und es zu begeistern. Ansonsten geht es stets darum, besser zu werden, in noch renommierteren Schauspielhäusern aufzutreten und endlich selbst zum Nationalschatz aufzusteigen.
Die Schönheit und Faszination des Kabuki entfalten sich allein in den eingangs beschriebenen Bühnenaufnahmen. Wenn Lee und sein tunesischer Kameramann Sofian El Fani die ganze Farbenpracht, jede minutiös einstudierte Bewegung und den dramatischen Vortrag in weiten Einstellungen festhalten. Oder wenn sie sich Kikuos aufwendig geschminktem Gesicht annähern, um uns Perspektiven auf das Kabuki-Schauspiel zu eröffnen, die dem Theaterpublikum verwehrt bleiben.
Ab dem 25. Dezember in den Deutschschweizer Kinos.
Bewertung:
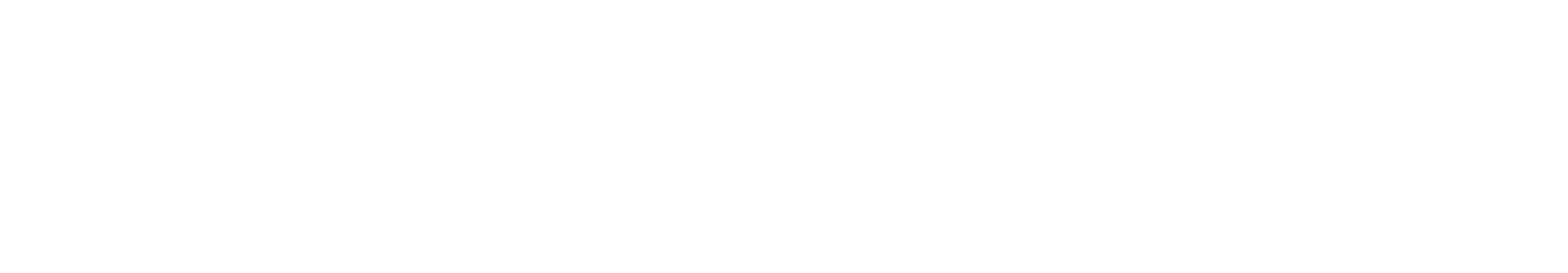

Hinterlasse einen Kommentar